Quelle: Tausendjähriges Morschen, Waltari Bergmann
Herausgeber: Gemeinde Morschen, 1985
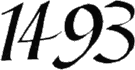 |
|
||
Bisherige Nonnen werden durch märkische Schwestern abgelöst. |
|||
| Es war eine Zeit des Sittenverfalls in den zumeist reichen, Mönche und Nonnen zu Wohlleben verführenden Klöstern. Landgraf Ludwig I. war eine Hauptstütze der Kirchenreform bis zu seinem Tode 1458. Der "gebürtige Spangenberger" (auf dem Schloß), dem Raum stets verbunden, war "von ungeheuchelter Frömmigkeit", die auch dem Papst imponierte, der ihn in Rom besonders auszeichnete. Als "Ludwig der Friedsame" ging er in die Geschichte ein. Er kannte auch Haydau genau. Von Bursfelde an der Oberweser ging das Mühen aus, die Kirchenzucht und Ordnung nach der Benediktinerregel wiederherzustellen, wie es u. a. auch in Breitenau geschah. Mit "Hilfe gleichgesinnter Äbte reiste Ludwig I. umher, um seine Klöster zu reformieren. Das Kloster der Augustiner-Nonnen zu Eppenberg ohnweit Felsberg war in großem Verfall. Die anstößige Sittenlosigkeit der geistlichen Schwestern erforderte eine durchgreifende Maßnahme." Nun, er erhielt die Erlaubnis des Papstes Eugen IV.: die Schwestern wurden von Dekan des St. Martinsstiftes zu Kassel "versetzt", und die frommen Mönche vom Kartäuserorden, der wie die Zisterzienser aus Frankreich stammte, zogen ein. Es ist anzunehmen, daß wie Otto der Schütz 1359 dem Kloster aus Gut zu Altmorschen zehn Mark vermachte, auch Ludwig I. Stiftungen hier gab. Ludwig I. starb auch zu Spangenberg 1458, angeblich vergiftet. Der Chronist von damals meldete, daß Ludwig I. in einem Mönchskloster vergiftet worden war und starb. Hierzu Rommel: "!Als Mönchskloster in der Nähe käme nur das wenig bekannte Karmeliterkloster zu Spangenberg . . . in Frage. Es könnte also nur an das Nonnenkloster Haydau gedacht werden, wo Landgraf Hermanns Gemahlin Margaretha ein ewiges Seelengeräte für ihre ganze Familie gestiftet hatte (und eine Schwester Ottos d. Schützen Nonne war und hier starb)." 1493 reformierte Landgraf Wilhelm II. das Kloster Haydau "durch neue Zisterzienserinnen", und da Haydau im Bezirk Spangenberg lag, so gab Landgraf Wilhelm I. (auf Schloß Spangenberg) seine Einwilligung, die zugleich seine letzte Amtshandlung war. |
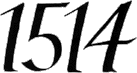 |
|
||
Ablaßerteilung durchs Kloster, Wallfahrtskapelle Haydau auf dem Kapellenberg. |
|||
| In den letzten Jahrzehnten vor der Reformation 1526 sah es auch im reichdotierten, der Hl. Maria geweihten Kloster Haydau ärmlicher aus. Die Äbtissin bemühte sich, durch Ablaßhandel und Bettelbriefe ihre finanziellen Sorgen zu mindern. 1493 war Haydau durch die sog. Bursfelder Benediktinerregel erneuert worden in Zucht und Ordnung. Landgraf Wilhelm II. der Mittlere (drei Brüder Wilhelm!) befreite Haydau von vielen Diensten und Pflichten. Wir lesen, daß auf dem Ostermarkt 1517 zu Cassel "auch die fromben Frauen zur Hayda" eine Bude aufgeschlagen hatten, in der eine verschleierte Nonne im Namen der Frau Äbtissin Elisabeth vom Rheine Gaben für das in Not geratene Kloster erbat. Der (Ablaß-}Brief sagte aus, daß die Äbtissin 7000 Tage Vergebung der tödlichen Sünden und 660 TageVergebung alltäglicher Sünden allen denen versprach, die dem Kloster Haydau Handreichung zur Nahrung tun und ihm behilflich sein wollten, mit willigen Almosen zu Kelchen, Altartüchern und zum ewigen Licht,welches in der Kirche in fünf Ampeln brannte. Auch allen, welche des Klosters Boten beherbergen, ihnen Wege und Stege zeigen würden, auf denen sie Geber finden mit ehrlich gewonnenem Gut, wurden 40 Tage Vergebung der Sünden zugesagt. "Überdies sollen sie theilhafftig werden aller guten Werke, welche in 1800 Mönchs- und 1400 Jungfrauenklöstern des Zisterzienserordens täglich geschahen (!) und über welche das Kloster Haydau päpstliche Bullen und Bücher besaß . . ." Eine Bibliothek ist seit der Reformation spurlos verschwunden. Diese Verlesung auf dem Ostermarkt war sehr erfolgreich. Männer und Frauen brachten herbei, was sie an Öl, Kornfrüchten, Obst, Wein, Wolle und Leinen entbehren konnten. Auch Stoffe für die Nonnenkleidung und Kleidung für den Altar "und für köstliches Gewand der Jungfrau Maria" wurden geschenkt bzw. gegen einen Ablaßbrief eingetauscht. Die Äbtissin sandte den "Bettelbrief" überall hin und erbat Mohn, Lein- und Rübsensamen zum "Gelüchte" der fünf Ampeln des ewigen Lichtes. 70 Personen waren immerhin im Kloster zu versorgen. Elisabeth empfahl das "Almosen als eine Arzney gegen den ewigen Tod, einen Port der Gnade, einen Weg des Himmels, eine Auslöschung der Sünde". |
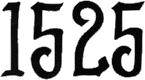 |
|
||
Bauern plünderten im Fuldatal. |
|||
| Das weit und breit immer noch als reich geltende Kloster war auch im Bauernkrieg Ziel der Plünderer und Unterdrückten. "Sind die bauren aus den gerichten Spangenberg und Morsen geweltiglich in das Closter zu Heida gefallen", lesen wir 1525. Das Gut des Landgrafen Philipp, der mit schlimmster Härte gegen die Bauern vorging, bei Niedergude gelegen, wurde vom dortigen Meier Jakob Stückrath verteidigt. (Ein späterer Stückrat rettete übrigens Schloß Spangenberg im 30j. Kriege.) Die Bauern warfen Feuerbrände ins Vorwerk. Stückrat starb bei der Verteidigung. Philipps Verweser zu Kassel teilte seinem Fürsten am 24. April 1525 mit: "Ich habe Euer fürstl. Gnaden Schultheißen Hans Winand zu Witzenhausen... gestern hier abgefertigt mit dem Befehl, geheimb zu erkundigen, was die dorfschaft(en) und gericht umb Spangenberg und Morsen willens sein und ob sie etwa Ufrur machen . . . " Am anderen Mittag schickte Winand den Melsunger Landknecht (Polizisten) zum Hofe: "Gestern Montag, den 24. April, sind die baurn aus den Gerichten Spangenberg, Morsen und darumbher nach 9 Uhr vor Mitternacht in das closter zur Heida geweltiglich gefallen." Sie nahmen alles mit, leerten alle Schränke und Kasten im Kloster und in der Kirche. Danach zogen sie wieder in ihre Höfe ab. Der Landgraf siegte, die Aufständischen wurden zum Teil mit dem Tode bestraft z.B. in Frankenhausen am Kyffhäuser. Bei uns sollen sie glimpflicher davongekommen sein, z. T. mit Freiheitsstrafen auf Schloß Spangenberg. |

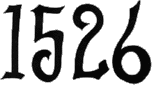 |
|
||
Das Kloster wird durch die Reformation aufgelöst. |
|||
| Vor Luther und der Reformation bei uns - im Oktober 1526 auf der Synode in Homberg - kam es bereits zu Versuchen, die Klöster zu reformieren, d. h. Unsitten und allzu Weltliches auszumerzen. Vor 1500 hatten viele Klöster einen schlechten Ruf, besonders auch das Kloster Eppenberg nahe der heutigen Domäne Mittelhof, wo der Landgraf die Nonnen auswies: Ludwig I. der Friedfertige wies in das Kloster Eppenberg, in dem seit 1219 am Fuße des Heiligenberges Augustinerinnen gewirkt hatten, nunmehr schweigsame Kartäusermönche aus Erfurt ein, deren Kloster 1527 wie Haydau aufgelöst und der letzte Prior des Klosters Kartause, Johannes Lening, evangelischer Pfarrer in Melsungen und bekannter Ratgeber Philipps des Großmütigen wurde. Landgraf Wilhelm löste auch die "zu verweltlichten" Zisterzienserinnen zur Haydau in 1493 ab und ersetzte sie durch Nonnen aus Kentrup (Mark Brandenburg). Vorausgegangen war eine Klostervisitation durch den Abt des Klosters Walkenried (Harz). Das Kloster genoß neues Ansehen; viele Adelstöchter fanden hier Zuflucht. Kloster und Kapelle "zur Heide" wurden als Wallfahrtsorte aufgesucht, sogar 1514 vom Landgrafen und Bürgern aus Kassel, die hier Ablaß kauften. Des Landgrafen Ehefrau Anna, geborene Herzogin v. Braunschweig, schrieb im März 1514: "Volgend ist es dahin gediehen, daß unser lieber Her und gemahl (Wilhelm, residierend auf Schloß Spangenberg) vorgnumen, gegen der Heiden zu wallfahrten. Etzliche aus Cassel waren gerade da zum Ablasse im Kloster." Trotz neuer Wertschätzung war das Kloster wirtschaftlich in Armut geraten, wie wir ja dem "Bettelbrief" der Äbtissin Elisabeth vom Rheine (aus Spangenberg) entnahmen (1517). Das Kloster hatte auch die Präbende des Weinmeisters zu Neumorschen vom Landgrafen Wilhelm empfangen. Wir kennen aus den Urkunden die Namen der letzten "Amtsjungfrawen zur Heide", auch die Höhe ihrer Abfindungen bzw. Renten, die sie ab Verlassen des Klosters 1527/28 erhielten. Die meisten kehrten zu ihren Familien in die Heimat zurück. Landgraf Philipp hatte strenge Anweisungen gegeben, daß das von ihnen ins Kloster Eingebrachte an Vermögen, Erbschaft und Geldern, das Geld für die "Leibzucht" und zur Einsegnung als Nonne (ca. 25 Gulden) ihnen erstattet bzw. in Jahresrenten an Frucht und Geldern umgewandelt wurde. Dabei war auch das sog. "Brustlatzgeld". Nicht wenige entlassene Amtsjungfrauen waren Adelstöchter der engeren und weiteren Heimat Nordhessens. Eine Bemerkung hält fest, daß es in Haydau 34 Nichtadlige gab. Nicht unmöglich, daß einige Nonnen schon vorher weggelaufen waren, wie z. B. zehn Zisterzienserinnen aus dem sächsischen Kloster Nimbschen, unter denen Luthers spätere Frau Katharina v. Bora war. Das sehr reichlich verbleibende Klostergut wurde künftig für die Armen, die Schulen, Kirchen, Besoldungen von Pfarrern und Lehrern, für Hospitäler und Siechenhäuser, vor allem zu Spangenberg und Melsungen, für milde Stiftungen und nicht zuletzt die 1527 gestiftete erste evangelische Universität der Welt in Marburg verwandt. Haydau brachte jährlich 1820 Gulden an Abgaben ein, das sind ca. 40-50000 DM heute (1991). |