|
Die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn (FWNB)
Knapp
ein Jahrzehnt nach der Erffnung der ersten deutschen Eisenbahn
zwischen Nrnberg und Frth im Dezember 1835 begann man am 1. Juli 1845
in der Nhe von Guxhagen in Kurhessen mit dem Bau von Eisenbahnen. Nach
jahrelangem innenpolitischem Hin und Her sowie zhen Verhandlungen mit
Preu§en und den thringischen Nachbarstaaten hatte ãKurprinz und
MitregentÒ Friedrich Wilhelm am 2. Oktober 1844 die Statuten einer
Aktien-Gesellschaft fr den Bau der ãFriedrich-Wilhelms-NordbahnÒ
genehmigt, wobei ein Bankenkonsortium, bestehend aus den Bankhusern
Bernus du Fay (Hanau), Gebr. Bethmann und Ph. M. Schmidt (beide
Frankfurt a.M.), das notwendige Kapital von 8 Mio. Talern durch Ausgabe
von Aktien bereitstellen sollte.
Der
Bau der Strecke von Haueda an der preu§isch-westflischen Grenze bis
nach Gerstungen war in insgesamt 12 Sektionen aufgeteilt worden, dazu
wurden gesondert die Tunnelbauten vergeben. Die Station Altmorschen
befand sich im Bereich der ãSection 9Ò, die vom Pfieffrain bei
Melsungen bis nach Heinebach reichte. Der Bau der Strecke in der
ãSection 9Ò (ohne den Tunnel bei Beisefrth) war an die Fa. Wachsmann
& Manch vergeben worden, die Bauleitung hatte ãSectionsingenieurÒ
Krdell. Am 7.April 1847 erhielt die Fa. Wachsmann & Manch auch
den Zuschlag fr die Bauten ãder Station Altmorschen (dem
Einmndungspunkte einer demnchst aus der Gegend von Lichtenau und
Eschwege ber Spangenberg herangefhrt werdenden Wegverbindung), in
einem Anschlage von 19.000 TalernÒ mit der ãVerpflichtung der
Beendigung bis zum 1. Juli 1848Ò, so der Geschftsbericht der FWNB aus dem Jahre 1847.
Beim
Bau der Bahn hatte man eine klare Aufgabentrennung vorgenommen:
Oberingenieur Dr. Francois Splingard aus Namur/Belgien baute die
Strecke, fr die Hochbauten wie z. B. die Bahnhofsgebude war der
kurhessische Hofbaumeister Julius Eugen Ruhl zustndig. Splingrad und
Ruhl arbeiteten eng zusammen und koordinierten ihre Aktivitten, z. B.
auch die Lage von Bahnhofsgebuden bei den entsprechenden Ortschaften.
Das Bahnhofsgebude von Altmorschen
Julius
Eugen Ruhl hat mit seinen Entwrfen den Stil der Bahnhofsbauten der
Friedrich-Wilhelms-Nordbahn und des kurhessischen Abschnitts der
Main-Weser-Bahn entscheidend geprgt, viele Plne, Skizzen und Entwrfe
sind von ihm erhalten. Den meisten von ihnen sind folgende Aspekte
gemeinsam:
|
- -
|
die Einfhrung des unverputzten massiven Ziegelbaus aus Grnden der Dauerhaftigkeit und des Eindrucks solider Qualitt,
|
|
- -
|
die Bevorzugung eines Rundbogen-Stils,
|
|
- -
|
die Zergliederung des Bauwerks in tragende (Pfeiler), umschlie§ende (Wnde) und dekorierende
Elemente (Rundbgen, Gesimse, Zahnfriese, Formsteine),
|
|
- -
|
die Nutzung rasterfrmiger Grundrisse.
|
|
|
|
Den Ruhlschen Vorstellungen nachempfundene Rekonstruktion des Altmrscher Bahnhofs von R. Salzmann
|
Vom
Altmrscher Bahnhof ist kein Entwurf erhalten, der sich explizit auf
Ruhl zurckfhren lsst. Ein Vergleich mit den von Ruhl entworfenen
Bahnhfen wie z. B. in Hofgeismar, Melsungen oder Rotenburg a. d. Fulda
aber machen mehr als deutlich: Es sind Ruhls Vorstellungen, die hier in
Altmorschen umgesetzt wurden.
Obwohl das Gebude in der Gemarkung Neumorschen gelegen war, erhielt die Station den Namen ãAltmorschenÒ.
Es hei§t, dass dies auf Wunsch des Kurfrsten geschehen sei, auch wegen
der Verbindung zum Kloster Haydau, das damals als Staatsdomne im
Besitz des Kurfrsten war. Die Ausfhrungen des Geschftsberichts
1846/47 der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn lassen aber eher den Schluss
zu, dass wegen der Wegeverbindung von Lichtenau bzw. Eschwege ber
Spangenberg nach Homberg in Altmorschen das entsprechende
Verkehrsaufkommen erwartet wurde. Nicht zuletzt stand zwischen Alt- und
Neumorschen damals die einzige Fuldabrcke zwischen Melsungen und
Rotenburg.
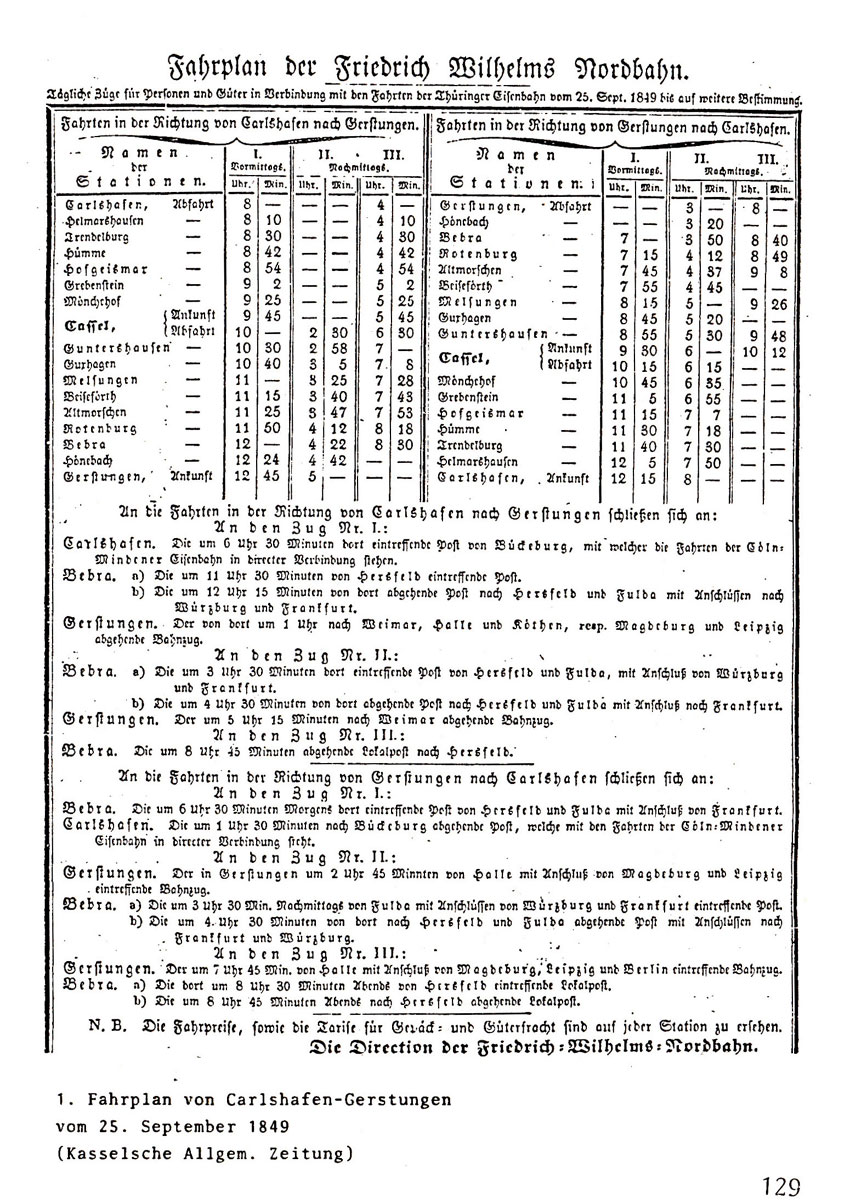 |
|
Zum Vergr§ern Plan anklicken!
|
Offiziell
soll der Bahnhof am 15.5.1852 feierlich eingeweiht worden sein, knapp
vier Jahre nach Aufnahme des Bahnbetriebs zwischen Guxhagen und Bebra.
Bereits im ersten Fahrplan fr die Gesamtstrecke der FWNB vom 25.
September 1849 sind in Altmorschen sechs Zughalte verzeichnet, d. h.,
es gab bereits Personenverkehr in mglicherweise provisorischen, noch
nicht komplett fertig gestellten Einrichtungen. Das zeigt auch
der Geschftsbericht der FWNB von 1849, der fr den Zeitraum vom
30. Mrz 1848 bis zum 31. August 1849 fr den Bahnhof Altmorschen
14 303 befrderte Personen und 4858,5 Zentner transportierte Gter
ausweist.
Angesichts der
vertraglichen Verpflichtung des Bauunternehmens, das Gebude bis Juli
1848 fertigzustellen, wirft der Erffnungstermin 1852 Fragen auf. Im
Geschftsbericht von 1849 der - sich damals in finanziellen Nten
befindlichen - FWNB-Gesellschaft liest man: ãBei Ausfhrungen der
Hochbauten haben wir durch Vereinfachung derselben und Beschrnkung auf
die zum Betrieb nothwendigen Einrichtungen nicht unbedeutende
Ersparnisse eintreten lassen.Ò Mglicherweise betraf dieser Sparkurs auch Altmorschen, so dass erst 1852 das Gebude komplettiert war.
Im Band 2.1 der ãKulturdenkmler in Hessen. EISENBAHN IN HESSENÒ wird das Altmrscher Bahnhofsgebude als ãehemals
symmetrisches Backsteingebude von 1848 auf H-frmigen Grundriss
(2:3:2-Achsen) É , seit ca. 1850 beidseitig verlngert und nach Norden
um einen Turm ergnzt, zuletzt 1893 verndertÒ beschrieben. Dieser
H-frmige Grundriss lsst sich heute noch erkennen, wenn man sich
gedanklich den nrdlichen Turm sowie den sdlichen Anbau wegdenkt.
Allerdings hatten bis auf den zweistckigen Haupttrakt (und dem spter
angefgten Turm) die Gebudeteile noch nicht die Hhe, in der wir sie
jetzt vorfinden.
Die
verwendeten Baumaterialien (Klinkersteine) lassen diesen H-frmigen
Ursprungsgrundriss erkennen, den zweigeschossigen Hauptbau mit
angedeuteten Giebeln (ãRisaliteÒ) auf beiden Seiten, ein traufstndiger
flacher Bau stellt die Verbindung zu einem weiteren, mit Giebel zum
Gleis ausgerichteten Anbau her, der gleich breit, aber niedriger als
der Haupttrakt war. Der nrdlich angefgte dreistckige Turm war bis
zum Zeitpunkt der Erffnung 1852 offenbar noch nicht komplett
vorhanden, drfte aber nicht lange danach fertig gestellt worden
sein, da in ihm der einzige Treppenaufgang zum Obergeschoss
eingebaut war. Da die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn trotz Erprobung von
ãTelegraphenÒ (gemeint sind fest installierte optische Signale)
zunchst den Betrieb mit Handsignalen regelte, die von Wrter zu Wrter
gegeben wurden, was eine Sichtverbindung zwischen Bahnwrterhusern und
Bahnhfen erforderte. Die 1948 herausgegebene Festschrift zum
100jhrigen Jubilum der FWNB vermutet, dass der Turm ãeine Art
Wachturm darstellte. Nach berlieferung alter Eisenbahner befand sich
im Erdgeschoss des Gebudes im Anschluss an den Turm, in dem die Treppe
zu den oberen Stockwerken hinauffhrte, das Telegrafenzimmer. Durch
diese Anordnung war es mglich, schnell auf die obere Plattform zu
gelangen, um die sich nhernden Zge schon von weitem zu beobachten und
ihnen u. U. Signale geben zu knnen.Ò Gegen diese Vermutung
spricht, dass auf allen Zeichnungen und Abbildungen der Trme, die es
in gleicher Form z.B. auch bei den Bahnhfen in Hofgeismar, Melsungen
oder Rotenburg gab, diese mit einer Haube abgedeckt sind. In erster
Linie war ein solcher Turm wohl ein Uhrenturm, vor allem befand sich in
ihm Ð wie erwhnt - der Treppenaufgang vom Erdgeschoss zum ersten Stock.
Die
Beschaffung der Baumaterialien spiegelt die damalige industrielle
Rckstndigkeit des Agrarstaates Kurhessen wider: Der Schiefer fr die
Dacheindeckung wurde aus England bezogen, ebenso Kupferblech und
Kupferngel, spter verzinkte Eisenngel. Der Turm wurde mit Zinkblech
ber Dielenschalung abgedeckt. Inwieweit die von Dr. Francois Splingard
fr den Bahn- und Tunnelbau aus Belgien herangeholten Ziegelbrenner
auch Klinker fr den Bahnhof in Altmorschen hergestellt haben, ist
unklar. Da aber Streckenbau und Bahnhofsbau in der Hand einer Firma
lagen, knnte man Synergieeffekte bei der Materialbeschaffung vermuten.
In den Entwrfen Julius Eugen Ruhls, die dem Altmrscher Bahnhofstyp
entsprechen, zeigt sich eine typische Anordnung der Innenrume. Fr
Altmorschen kann man daher fr den Bau in seiner ursprnglichen
Ausfhrung folgende Aufteilung annehmen:
- Erdgeschoss:
Im Turm der Treppenaufgang zur Vorsteher-Wohnung im ersten Stock des Haupttrakts.
Im Haupttrakt Dienstrume (Billets, Gepck) .
Im Verbindungsbau Warterume .
Im sdlichen Anbau Frstenzimmer mit gesondertem Zugang von der Seite.
- Erster Stock:
Im Turm Treppenaufgang zum 2. Turmgeschoss sowie Toilette fr die Vorsteher- Wohnung.
Im Haupttrakt Vorsteher-Wohnung
Diese eine Wohnung gengte, denn in Altmorschen waren wie ãauf
allen Stationen zweiter Klasse (É) die Funktionen des
Stations-Inspectors, Einnehmers, Gter- und Gepckexpedienten einem
einzigen Beamten bertragen, welcher bei verschiedenen Geschften nur
durch einen Wieger untersttzt wirdÒ , so der Geschftsbericht der
FWNB von 1848/49. Nur in Karlshafen, Kassel und Bebra wurde damals
zustzliches Personal eingesetzt.
Sptere Vernderungen des Bahnhofsgebudes
Durch
die aktuelle, 2012 abgeschlossene Aufarbeitung des Gebudes in
Altmorschen ist es mglich geworden, einen Eindruck vom ursprnglichen
u§eren Erscheinungsbild der Bahnhfe aus der Anfangszeit der
Friedrich-Wilhelms-Nordbahn zu bekommen. Allerdings zeigt sich der
heutige Bahnhof in einer gegenber dem Zustand der 1850er Jahre baulich
in vieler Hinsicht verndert und ergnzt. Folgende spteren Umbauten
bzw. Anbauten, die z. B. durch die Verwendung anderer
Klinkerstein-Formate oder an unterschiedlichen Radien der Fensterbgen
zu erkennen sind, kann man am Empfangsgebude feststellen:
- Anbau zweistckiger sdlicher Flgel mit Restauration und Wohnung fr den Gastwirt
- Aufstockung mittlerer Bau,
- Aufstockung sdlicher, giebelstndiger Trakt,
- Anbau Portikus (stra§enseitiger Eingang),
- stra§enseitiger zweistckiger Anbau an Turm, gleiche Hhe wie Mittelbau und Sdflgel.
Wann
die Erweiterungsbauten vorgenommen wurden, ist nicht genau bekannt. Die
ãKunstdenkmler in HessenÒ geben an, dass der Bahnhof bis zum Jahre
1893 umgebaut worden sei.
 Ein
Foto aus dem Jahre 1914 zeigt das Gebude in der Form, wie wir es heute
kennen, mit allen oben aufgefhrten An- und Umbauten. Dort ist auch der
Gterschuppen zu sehen, der mitsamt Ladegleis zur berdachten Rampe am
Schuppen etwa um 1910 gebaut worden sein drfte. Ein anderer
Postkartenausschnitt zeigt die Stra§enfront des Gebudes mitsamt dem
angebauten Portikus - die Uniformen der Eisenbahner und der teilweise
sichtbare Gterschuppen erlauben den Schluss, dass auch dieser Vorbau
mit Treppenaufgang und Windfang um diese Zeit entstanden ist.
Sicherlich war hiermit beabsichtigt, die betrieblichen Ablufe
innerhalb des Gebudes zu verbessern. In den frhen Entwrfen Ruhls gab
es am Eingang oft einen quer liegenden Flur (ãVestibulumÒ), von dem aus
die im Seitenflgel liegenden Warterume zu erreichen waren und die den
Reisenden nach Betreten des Gebudes zu einer Querbewegung zwangen. Der
ãnatrliche WegÒ eines Reisenden war nmlich eher der, dass er sich
nach Betreten des Gebudes geradeaus, direkt zum Gleis hin bewegte,
indem er sein Billet kaufte und eventuell Gepck aufgab, um dann auf
den Bahnsteig zu gelangen. So sind im Laufe der Jahre eigentlich alle
Bahnhfe entsprechend umgebaut worden. In diesem Zusammenhang ist
mglicherweise der Umbau der ursprnglich einflgeligen Tr vom
Verwaltungstrakt zum Bahnsteig in zwei nebeneinander liegende Tren
erfolgt. Ein
Foto aus dem Jahre 1914 zeigt das Gebude in der Form, wie wir es heute
kennen, mit allen oben aufgefhrten An- und Umbauten. Dort ist auch der
Gterschuppen zu sehen, der mitsamt Ladegleis zur berdachten Rampe am
Schuppen etwa um 1910 gebaut worden sein drfte. Ein anderer
Postkartenausschnitt zeigt die Stra§enfront des Gebudes mitsamt dem
angebauten Portikus - die Uniformen der Eisenbahner und der teilweise
sichtbare Gterschuppen erlauben den Schluss, dass auch dieser Vorbau
mit Treppenaufgang und Windfang um diese Zeit entstanden ist.
Sicherlich war hiermit beabsichtigt, die betrieblichen Ablufe
innerhalb des Gebudes zu verbessern. In den frhen Entwrfen Ruhls gab
es am Eingang oft einen quer liegenden Flur (ãVestibulumÒ), von dem aus
die im Seitenflgel liegenden Warterume zu erreichen waren und die den
Reisenden nach Betreten des Gebudes zu einer Querbewegung zwangen. Der
ãnatrliche WegÒ eines Reisenden war nmlich eher der, dass er sich
nach Betreten des Gebudes geradeaus, direkt zum Gleis hin bewegte,
indem er sein Billet kaufte und eventuell Gepck aufgab, um dann auf
den Bahnsteig zu gelangen. So sind im Laufe der Jahre eigentlich alle
Bahnhfe entsprechend umgebaut worden. In diesem Zusammenhang ist
mglicherweise der Umbau der ursprnglich einflgeligen Tr vom
Verwaltungstrakt zum Bahnsteig in zwei nebeneinander liegende Tren
erfolgt.
 Ab
dem Jahre 1853 durfte sich die Bahn ãKurfrst-Friedrich-Wilhelms-
NordbahnÒ nennen, die Initialen ãKFWNBÒ zierten nun die Fahrzeuge. Mit
der Okkupation Kurhessens durch Preu§en im Jahre 1866 war das Ende der
kurfrstlichen Herrschaft gekommen, Kurfrst Friedrich Wilhelm I. ging
nach Prag ins Exil. Der Name der Eisenbahngesellschaft wurde in
ãHessische Nordbahn-GesellschaftÒ gendert, ab 1868 wurde die Strecke
von der ãBergisch-Mrkischen EisenbahngesellschaftÒ betrieben, welche
wiederum 1882 von Preu§en verstaatlicht wurde. Es war so auch die
Notwendigkeit entfallen, einen gesonderten Wartesaal fr die
kurfrstliche Familie vorzuhalten. blicherweise wurden dann die
Warterume umgewidmet: Das Frstenzimmer wurde so zum ãWarteraum 1. und
2. KlasseÒ. Beim Anbau der Gastwirtschaft wurde in diesem Bereich die
Kche eingerichtet, dazu die Treppe ins Obergeschoss. Die
Klassentrennung der Warterume war entfallen, auch wurde durch den
Gaststtten-Anbau zustzlicher ãWarteraumÒ gewonnen, so dass jetzt
Platz fr eine gro§zgigere, zentrale Schalterhalle war, in der der
Reisende alle notwendigen Geschfte - Fahrkarte kaufen, Gepck aufgeben
- erledigen konnte. Ab
dem Jahre 1853 durfte sich die Bahn ãKurfrst-Friedrich-Wilhelms-
NordbahnÒ nennen, die Initialen ãKFWNBÒ zierten nun die Fahrzeuge. Mit
der Okkupation Kurhessens durch Preu§en im Jahre 1866 war das Ende der
kurfrstlichen Herrschaft gekommen, Kurfrst Friedrich Wilhelm I. ging
nach Prag ins Exil. Der Name der Eisenbahngesellschaft wurde in
ãHessische Nordbahn-GesellschaftÒ gendert, ab 1868 wurde die Strecke
von der ãBergisch-Mrkischen EisenbahngesellschaftÒ betrieben, welche
wiederum 1882 von Preu§en verstaatlicht wurde. Es war so auch die
Notwendigkeit entfallen, einen gesonderten Wartesaal fr die
kurfrstliche Familie vorzuhalten. blicherweise wurden dann die
Warterume umgewidmet: Das Frstenzimmer wurde so zum ãWarteraum 1. und
2. KlasseÒ. Beim Anbau der Gastwirtschaft wurde in diesem Bereich die
Kche eingerichtet, dazu die Treppe ins Obergeschoss. Die
Klassentrennung der Warterume war entfallen, auch wurde durch den
Gaststtten-Anbau zustzlicher ãWarteraumÒ gewonnen, so dass jetzt
Platz fr eine gro§zgigere, zentrale Schalterhalle war, in der der
Reisende alle notwendigen Geschfte - Fahrkarte kaufen, Gepck aufgeben
- erledigen konnte.
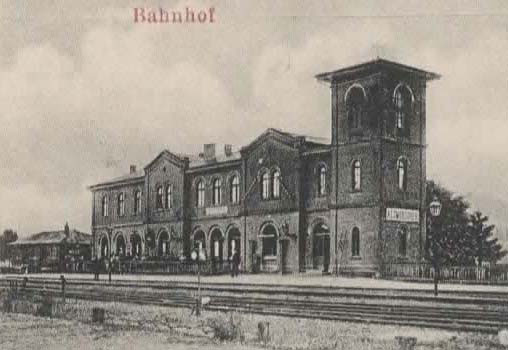 Auf
einer lteren Postkarte ist an der Stelle, an dem 1914 der
Gterschuppen steht, ein etwas kleineres, einstckiges mit einem
Walmdach versehenes Gebude zu sehen, mglicherweise ein frherer
Gterschuppen. Erkennbar ist hier auch, dass im Bereich der Dienstrume
nur eine Tr zum Bahnsteig fhrt, 1914 waren es zwei Tren. Auch sind
die Porzellanisolatoren der Telegrafenleitungen an der Gebudewand
anders angeordnet. Die im Vordergrund liegende Weiche ist per Hand
ãortsbedientÒ, d. h., sie hatte keinen Anschluss an ein Stellwerk.
Anzunehmen ist, dass in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ein
Stellwerk errichtet wurde, auch gab es wohl innerhalb des
Bahnhofsgebudes Vernderungen (neuer/anderer Telegrafenraum, Raum fr
Fahrdienstleiter). Interessant auf dem lteren Bild ist der mit einem
niedrigen Lattenzaun umschlossene Biergarten der Bahnhofswirtschaft,
der spter dem Ladegleis des neuen Gterschuppens weichen musste. Eine
genaue Datierung dieser Situation ist schwierig, ein anderes Indiz
knnte aber auf einen Zeitpunkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts
hinweisen: Im Oktober 1895 hat die damals neu eingerichtete ãKnigliche
Eisenbahndirektion CasselÒ der Preu§ischen Staatsbahn die Einrichtung
von Sperren vorgeschrieben: Nur noch mit Fahrkarte oder mit
Bahnsteigkarte war es erlaubt, den Bahnsteig zu betreten. Um die
notwendige Kontrolle zu erleichtern, machte es aus Bahnsicht Sinn, die
Fahrgastbewegung zu ãkanalisierenÒ, d. h. sie zu einem einzigen Ausgang
zu leiten, an dem die Kontrolle der Billets vorgenommen wurde. Fr ein
Bahnhofsgebude bedeutete dies z. B., dass durch Umbauten die Ausgnge
zum Bahnsteig bis auf einen verschlossen wurden, einschlie§lich der
Ausgnge einer Bahnhofswirtschaft ins Freie. Alternativ wurde die
Freiflche der Wirtschaft durch einen hheren Zaun abgegrenzt. Auf
einer lteren Postkarte ist an der Stelle, an dem 1914 der
Gterschuppen steht, ein etwas kleineres, einstckiges mit einem
Walmdach versehenes Gebude zu sehen, mglicherweise ein frherer
Gterschuppen. Erkennbar ist hier auch, dass im Bereich der Dienstrume
nur eine Tr zum Bahnsteig fhrt, 1914 waren es zwei Tren. Auch sind
die Porzellanisolatoren der Telegrafenleitungen an der Gebudewand
anders angeordnet. Die im Vordergrund liegende Weiche ist per Hand
ãortsbedientÒ, d. h., sie hatte keinen Anschluss an ein Stellwerk.
Anzunehmen ist, dass in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ein
Stellwerk errichtet wurde, auch gab es wohl innerhalb des
Bahnhofsgebudes Vernderungen (neuer/anderer Telegrafenraum, Raum fr
Fahrdienstleiter). Interessant auf dem lteren Bild ist der mit einem
niedrigen Lattenzaun umschlossene Biergarten der Bahnhofswirtschaft,
der spter dem Ladegleis des neuen Gterschuppens weichen musste. Eine
genaue Datierung dieser Situation ist schwierig, ein anderes Indiz
knnte aber auf einen Zeitpunkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts
hinweisen: Im Oktober 1895 hat die damals neu eingerichtete ãKnigliche
Eisenbahndirektion CasselÒ der Preu§ischen Staatsbahn die Einrichtung
von Sperren vorgeschrieben: Nur noch mit Fahrkarte oder mit
Bahnsteigkarte war es erlaubt, den Bahnsteig zu betreten. Um die
notwendige Kontrolle zu erleichtern, machte es aus Bahnsicht Sinn, die
Fahrgastbewegung zu ãkanalisierenÒ, d. h. sie zu einem einzigen Ausgang
zu leiten, an dem die Kontrolle der Billets vorgenommen wurde. Fr ein
Bahnhofsgebude bedeutete dies z. B., dass durch Umbauten die Ausgnge
zum Bahnsteig bis auf einen verschlossen wurden, einschlie§lich der
Ausgnge einer Bahnhofswirtschaft ins Freie. Alternativ wurde die
Freiflche der Wirtschaft durch einen hheren Zaun abgegrenzt.
Die
Ausbauten im ersten Stock des Empfangsgebudes dienten vor allem der
Bereitstellung von Wohnraum, fr die Dacheindeckung der Aufstockungen
wurde Teerpappe verwendet. Im Verwaltungstrakt selbst wurden Umbauten
aus betrieblichen Grnden wie zur Einrichtung des Telegrafenraumes oder
des Dienstraumes fr den Fahrdienstleiter vorgenommen. Noch bis Mitte
des 20. Jahrhunderts wurde in Altmorschen der Morsetelegraf im
Zugmeldeverfahren benutzt, bis er durch Telefone ersetzt wurde. Auch
bte der Fahrdienstleiter seine Funktion noch bis etwa 1950 im
Empfangsgebude aus, dann wechselte dieser Dienstposten auf das
sdliche Stellwerk am Bahnbergang der B 83. Whrend des Zweiten
Weltkriegs wurde 1941 im Keller unter den  Dienstrumen
ein Luftschutzraum eingerichtet. Dazu wurden eine Betondecke sowie
zustzliche, sttzende Mauern eingezogen. ber die Treppe im Turm
gelangte man durch eine Schleuse mit gassicherer Tr in den Schutzraum,
ein Notausgang fhrte durch den Kohlenkeller des Bahnhofswirts zu einer
Tr unterm Treppenaufgang am Vorplatz. Dienstrumen
ein Luftschutzraum eingerichtet. Dazu wurden eine Betondecke sowie
zustzliche, sttzende Mauern eingezogen. ber die Treppe im Turm
gelangte man durch eine Schleuse mit gassicherer Tr in den Schutzraum,
ein Notausgang fhrte durch den Kohlenkeller des Bahnhofswirts zu einer
Tr unterm Treppenaufgang am Vorplatz.
Im Gegensatz zu den meisten
anderen Klinker-Bahnhfen der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn war die
Fassade bis weit in die zweite Hlfte des 20. Jahrhunderts nicht
verputzt oder angestrichen worden, erst spter Mitte der 1970er Jahren
wurde ein dicker wei§er Anstrich aufgezogen.
 Am
23.September 1966 fuhren die ersten von E-Loks gezogenen Zge auf der
nunmehr elektrifizierten Strecke. Eine deutliche optische Vernderung
der Bahnanlage, aber auch einen Zugewinn an Sicherheit fr Autofahrer
und Fu§gnger waren im Jahre 1980 der Bau der Stra§enbrcke ber die
Bahn und die damit einher gehende Schlie§ung des Bahnbergangs ab dem
22.Juni 1981. Am
23.September 1966 fuhren die ersten von E-Loks gezogenen Zge auf der
nunmehr elektrifizierten Strecke. Eine deutliche optische Vernderung
der Bahnanlage, aber auch einen Zugewinn an Sicherheit fr Autofahrer
und Fu§gnger waren im Jahre 1980 der Bau der Stra§enbrcke ber die
Bahn und die damit einher gehende Schlie§ung des Bahnbergangs ab dem
22.Juni 1981.
Am
31.Mrz 1988 schloss der Fahrkartenschalter, Anschlussgleise wurden
stillgelegt. Kurz darauf gingen die beiden Stellwerksgebude au§er
Dienst, die neu installierten Lichtsignale werden seit Frhjahr 1989
von den Fahrdienstleitern in Beisefrth mitbedient. Im Jahre 1963 wurde
noch ein kleiner Fernmelderaum in die Lcke zwischen Bahnhofsgebude
und Gterschuppen gebaut, er ist mitsamt dem Schuppen vermutlich Anfang
der 1990er Jahre abgerissen worden. Der letzte Wirt der
Bahnhofswirtschaft, Peter Lentz, schloss nach 15jhriger Pachtzeit im
Jahre 1999 sein Lokal. Aus dem ãBahnhof AltmorschenÒ wurde der
ãHaltepunkt Morschen-AltmorschenÒ, als ãGebudeÒ fr den Bahnbetrieb
verbleiben zwei glserne Unterstnde auf modernisierten Bahnsteigen.
 |
 |
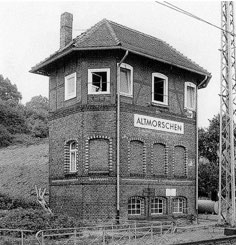 |
| Stellwerk am Bahnbergang Altmorschen |
Blick aus dem Stellwerk (links) auf den Bahnbergang Altmorschen und den Bahnhof |
Stellwerk am ehem. Bahnbergang nach Heina |
Ein Schmuckstck als Denkmal
 Zum Bahnhof Altmorschen schreibt die Broschre der Reichsbahndirektion Kassel von 1948: ãNur
die Gebude von Liebenau, Beisefrth und Altmorschen, deren Umbau der
Zweite Weltkrieg verhinderte, zeigen noch heute das ursprngliche Bild.Ò Die anderen Stationen seien durch Umbauten, ãAufbringung
eines schlichten Au§enputzesÒ und ãunter weitgehender Verbesserung auch
der inneren Anlagen in geschickter Weise so umgeformt worden, dass sie
unsere heutigen Ansprche auch in architektonischer Beziehung voll
erfllen und Schmuckstcke in der Reihe unserer Bahnhofsgebude
darstellenÒ. Diese 1948 mit dem Unterton des Bedauerns formulierte
Feststellung, dass der Umbau durch den Krieg ãverhindertÒ worden sei,
stellt sich aus heutiger Sicht fr das Empfangsgebude des Bahnhofs
Altmorschen als Glckfall dar: Nach Abschluss der
Rekonstruktionsarbeiten ist es mglich geworden, einen Eindruck vom
ursprnglichen u§eren Erscheinungsbild der Bahnhfe der
Friedrich-Wilhelms-Nordbahn zu bekommen. Es bleibt dankenswerter Weise
so mit diesem Gebude ein mit neuem Leben erflltes ãDenkmalÒ erhalten
- ein erfreuliches Einzelstck neben den auf modern getrimmten
Stationen in Melsungen oder Rotenburg und erst recht ein positiver
Kontrast zu den heruntergekommenen Bahnhofsgebuden, die die DB AG
vergeblich zu Ramschpreisen an den Mann zu bringen versucht. Zum Bahnhof Altmorschen schreibt die Broschre der Reichsbahndirektion Kassel von 1948: ãNur
die Gebude von Liebenau, Beisefrth und Altmorschen, deren Umbau der
Zweite Weltkrieg verhinderte, zeigen noch heute das ursprngliche Bild.Ò Die anderen Stationen seien durch Umbauten, ãAufbringung
eines schlichten Au§enputzesÒ und ãunter weitgehender Verbesserung auch
der inneren Anlagen in geschickter Weise so umgeformt worden, dass sie
unsere heutigen Ansprche auch in architektonischer Beziehung voll
erfllen und Schmuckstcke in der Reihe unserer Bahnhofsgebude
darstellenÒ. Diese 1948 mit dem Unterton des Bedauerns formulierte
Feststellung, dass der Umbau durch den Krieg ãverhindertÒ worden sei,
stellt sich aus heutiger Sicht fr das Empfangsgebude des Bahnhofs
Altmorschen als Glckfall dar: Nach Abschluss der
Rekonstruktionsarbeiten ist es mglich geworden, einen Eindruck vom
ursprnglichen u§eren Erscheinungsbild der Bahnhfe der
Friedrich-Wilhelms-Nordbahn zu bekommen. Es bleibt dankenswerter Weise
so mit diesem Gebude ein mit neuem Leben erflltes ãDenkmalÒ erhalten
- ein erfreuliches Einzelstck neben den auf modern getrimmten
Stationen in Melsungen oder Rotenburg und erst recht ein positiver
Kontrast zu den heruntergekommenen Bahnhofsgebuden, die die DB AG
vergeblich zu Ramschpreisen an den Mann zu bringen versucht.
 |
| Bahnhof Eingangsbereich |
Das
Empfangsgebude des Bahnhofs Altmorschen dient heute nach seiner
aufwndigen und stilgerechten Restaurierung der Firma B. Braun
Melsungen als Schulungs- und Trainingszentrum fr den
intensivmedizinischen Bereich.
|